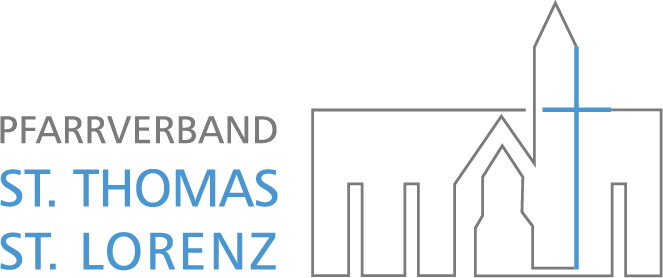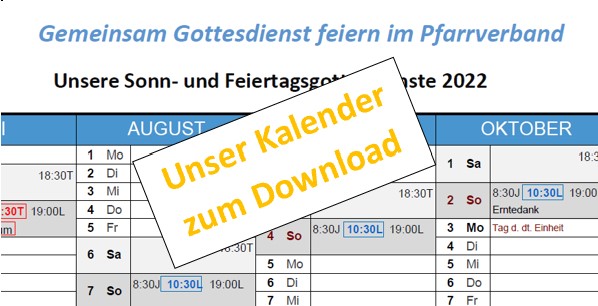Die Folgenden Meldungen können Sie nach einzelnen Kategorien filtern:
Gottesdienste Jugend Familien Senioren Konzerte Glaube und Gebet Freizeit Stellenanzeigen
Erntedankfeier 2022 im Kindergarten St. Johannes
Am 29. September haben wir mit den Kindern in den Gruppen Erntedank gefeiert. Jedes Kind hat von zuhause Obst, Gemüse oder Backwaren mitgebracht. Wir haben gemeinsam überlegt, wo die Lebensmittel herkommen und dankten Gott dafür. Anschließend haben wir sie uns bei einem gemeinsamen Frühstück schmecken lassen.
100 Jahre Kindergarten St. Lorenz
1922 Kath. Kindergarten St. Lorenz 2022
100 Jahre Kindergarten St. Lorenz – ein Rückblick
100 Jahre – eine lange Zeit. Für unsere Kindergartenkinder kaum vorstellbar.
Vieles hat sich in den Jahren und Jahrzehnten seit der Gründung des Kindergartens verändert: Das Bild vom Kind und damit verbunden verschiedene pädagogische Strömungen und Erziehungsansätze, der gesellschaftliche Wandel, Wertvorstellungen und Lebensentwürfe und nicht zuletzt das Verhältnis zu Religion und Kirche. All dies und noch vieles mehr hat Auswirkungen auf das Leben mit Kindern sowohl in der Familie als auch in der Erziehungsarbeit in Kindergärten, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen.
Die Pädagogik ist einem ständigen Wandel unterworfen – die Bedürfnisse der Kinder auch?
Heute gibt es ein breit gefächertes Spektrum, was das Angebot in vorschulischen Bildungseinrichtungen betrifft: Von Montessori-, Waldorf-, Natur- und Waldkindergärten bis hin zu Phorms, vom situations- oder subjektorientierten Ansatz, offenen oder halboffenen Konzept, Freilandpädagogik…ist die Rede. Eltern sollen oder dürfen sich vielmehr entscheiden, wo ihr Kind einen großen Teil des Tages verbringt und nach welchen pädagogischen Leitmotiven es erzogen wird.
Wie war es damals, 1922, als der Kindergarten gegründet wurde? Wie lebte und arbeitete man mit den Kindern? Welches Spielzeug/Materialien standen zur Verfügung? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, wandte ich mich vor mehr als 20 Jahren (zum 80-jährigen Jubiläum des Kindergartens) an Frau Maria Buchenberg, die über 50 Jahre, davon 44 Jahre als Leiterin, im Kindergarten
St. Lorenz tätig war und bekam einen reichen Schatz an Informationen.
Der Kindergarten wurde im Jahr 1922 durch H.H. Geistlichen Rat Manseicher, Pfarrer in St. Lorenz, gegründet. Der Kindergarten wurde getragen vom
St. Vinzentius-Verein, der durch die Beiträge der eingetragenen Mitglieder unterstützt wurde. Die Beiträge der Eltern waren zu dieser Zeit sehr gering. Unser Kindergarten war von Anfang an einer der wenigen unter der Leitung einer weltlichen „Kindergärtnerin“. Fast alle Einrichtungen dieser Art waren zu der Zeit unter der Trägerschaft einer Ordensgemeinschaft mit Schwestern besetzt. Die erste Unterbringung der Kinder erfolgte im Gebäude Muspillistr. 5. Von 8.00 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr besuchten etwa 30 Kinder aus den Familien von Bauern, Handwerkern und Arbeitern wie Maurern, Ziegeleiarbeitern etc. den Kindergarten. Am Mittwoch Nachmittag war der Kindergarten geschlossen, am Samstag Vormittag geöffnet. Die Kinder verbrachten somit zunächst nur entweder max. 4 Stunden in der Vormittagsgruppe bzw. max. 3 Stunden in der Nachmittagsgruppe im Kindergarten. Das Mittagessen wurde in der Familie eingenommen.
Die Einrichtung war sehr einfach. Holzbausteine (meist Abfälle aus der Oberföhringer Schreinerei), Stofftiere, Kaufladen, Papierabfälle aus der Druckerei waren Spiel- und Beschäftigungsmaterialien für die Kinder, dazu noch Naturmaterial wie Steine, Tannenzapfen und Blätter. Schaukelpferd, Puppenküche, Schubkarren und Sandspielzeug waren eine große Bereicherung. Töpfe, Schüsseln, Deckel und Kochlöffel aus dem Haushalt der damaligen Kindergärtnerin dienten den Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren als Musikinstrumente.
Auf der Längsseite des Kindergartens stand auf einem breiten Mauerband in großen gothischen Buchstaben: „Kindergarten des Vinzentius Vereins“ (dieses Mauerband ist auch heute noch zu sehen).
Nach Pfarrer Manseicher kam Geistl. Rat Ludwig Attenberger, unter dem der Kindergarten in den niederen Anbau verlegt wurde, der bis dahin als Turnhalle für die Jugend eingerichtet war. Dieser Raum wurde zum größten Gruppenraum des Kindergartens. Anstelle der ersten „Tante“ trat 1926 Frau Ida Hierstetter ihren Dienst als neue Leiterin des Kindergartens an und prägte ihrer Wirkungsstätte eine neue Note auf – ganz nach der Pädagogik Friedrich Fröbels.
Friedrich Fröbel (1782 – 1852) war der Begründer des ersten deutschen „Kindergartens“ und führte die „Freiarbeit“ (Freispiel) in die Pädagogik ein.
Das Spiel als typisch kindliche Lebensform hatte für ihn einen großen Bildungswert.
Die Pädagogik F. Fröbels und seine von ihm entwickelten Spiel- und Lernmaterialien sind auch heute noch in der Erziehungsarbeit von großer Bedeutung.
So wurde Fröbel-Material, wie z.B. Baukästen, Legetäfelchen, Flechtblätter, Stickkarten und dergleichen mehr angeschafft. Zu den wenigen Bilderbüchern kamen neue hinzu, es gab Malkreiden und Wasserfarben. Triangeln, Trommeln und Cymbeln lösten das „Küchenorchester“ ab.
Alle religiösen Feste im Jahreskreis wurden mit den Kindern gefeiert.
Zur Johannisbeer-, Kirschen- oder Birnenzeit wurde der Tisch feierlich für diese Kostbarkeiten gedeckt. Im Winter waren natürlich Schneeballschlacht, Schneemannbauen und oft sogar rodeln angesagt, was zu damaliger Zeit auf dem noch ganz freien Gelände um die ehemalige Ziegelei möglich war. Die Natur, das freie Gelände rund um den ehemaligen „Dorfkern“, in dem sich der Kindergarten befand, waren neben dem Kindergartengelände Spielorte für die Kinder. Das Erleben der Jahreszeiten, Sinneserfahrungen in der Natur waren für die Kinder selbstverständlich und bedurften keiner dafür speziell angesetzten „Aktionstage“ oder „Projekte“.
Frau Maria Buchenberg, die schon seit 1939 im Kindergarten mitarbeitete, löste 1944 „Tante Ida“ als Leiterin ab.
In den Jahren nach dem Krieg herrschte große Armut, auch im Kindergarten.
Bis 1950 war die Zahl der Kinder auf 45 – 50 angestiegen – ohne Hilfskraft, heute unvorstellbar!
In den Jahren 1959/60 wurde unter Pfarrer Mühlegger ein neuer Anbau Wirklichkeit.
50 Kindergartenkinder wurden für 11 Monate in die 3-Zimmer-Wohnung des Mesners ausquartiert. Im Juli 1960 konnte der Neubau (Anbau an den bereits bestehenden Teil) bezogen werden. Weitere Bauvorhaben folgten, um die Vorschriften des Bayer. Kindergartengesetzes zu erfüllen: Der überdachte Freisitz wurde zu einem Gruppenzimmer, der Luftschutzkeller Gymnastikraum, die an den Kindergarten angrenzenden Wohnung wurde zum „Intensivraum“.
Erst nach Erfüllung all dieser notwendigen Auflagen wurden am 1. Januar 1978 vom Schulreferat der Landeshauptstadt München die endgültige Anerkennung und damit verbunden finanzielle Zuschüsse erteilt.
Mit großem Engagement leitete „Tante Maria“ den Kindergarten über 4 Jahrzehnte. Die von ihr praktizierte Arbeitsweise gründete ebenfalls im Wesentlichen auf der Erziehungsphilosophie Friedrich Fröbels sowie auf der Basis christlicher Grundwerte. Viele der Gedanken dieses großen Pädagogen sind bis heute in unserem Kindergarten selbstverständlich. So war z.B. die maßgebende Grundlage der Kindergartenpädagogik für Fröbel, wie zuvor erwähnt, das SPIEL:
„Das Spiel dieser Zeit ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung…
Spiele sind Herzblätter des ganzen künftigen Lebens:
Ein Kind, welches tüchtig, still, ausdauernd, bis zur körperlichen Ermüdung spielt,
wird gewiß auch ein tüchtiger, stiller, ausdauernder, Fremd- und Eigenwohl mit Aufopferung befördernder Mensch.“
Die Hauptziele der Pädagogik sind mit denen in der heutigen Kindergartenarbeit identisch: Die Förderung der Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung des Kindes sowie der Sinneswahrnehmung (das Greifen kommt vor dem „Be-Greifen“).
Frau Maria Buchenberg übergab 1988 die Leitung an Frau Ruth Mühlenmeister
(1988 – 1990), es folgten Frau Christa Schlothauer (1990 – 1998), Sr. Jutta Beck
(1998 – 2000) und seit 2000 Frau Martina Weiss.
Unter Pfarrer Bernhard Bienlein wurde der schon lange anstehende Neubau Wirklichkeit. Nach über 2 Jahren Unterbringung in Containern im Pfarrgarten während der Bauphase, konnten im Frühjahr 2005 über 70 Kindergartenkinder in den zweigruppigen Neubau bzw. eine Gruppe in den sanierten Teil im Altbau „einziehen“.
Seit dem 1.8.2005 ist das bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit Ausführungsverordnungen in Kraft getreten, nach dessen Grundlagen sich die heutige Arbeit in den Kindergärten auszurichten hat.
In den letzten Jahren wurde überlegt, ob und wie man die im Altbau befindliche „Tigerentengruppe“ an das Haupthaus angliedern könnte.
Im Jahr 2021 hat die Kirchenstiftung St. Lorenz beschlossen, den Betrieb der Gruppe im Altbau bis Ende August 2022 laufen zu lassen und ab September 2022 aufgrund baulicher Mängel des gesamten Gebäudes einzustellen.
Somit verbleiben 2 Gruppen im Haupthaus.
Und was wünschen wir dem Kindergarten für die Zukunft?
Ich wünsche dem Kindergarten St. Lorenz vor allem immer wieder Menschen, die mit viel Liebe, Geduld, Kreativität und der nötigen Gelassenheit an ihre Arbeit herangehen, weil Kinder sich nur dort gut entwickeln können, wo sie sich wohl und geborgen fühlen und auch das hat sich über die Jahre nicht verändert…
Martina Weiss
100 Jahre Kindergarten St. Lorenz
1922 Kath. Kindergarten St. Lorenz 2022
100 Jahre Kindergarten St. Lorenz – ein Rückblick
100 Jahre – eine lange Zeit. Für unsere Kindergartenkinder kaum vorstellbar.
Vieles hat sich in den Jahren und Jahrzehnten seit der Gründung des Kindergartens verändert: Das Bild vom Kind und damit verbunden verschiedene pädagogische Strömungen und Erziehungsansätze, der gesellschaftliche Wandel, Wertvorstellungen und Lebensentwürfe und nicht zuletzt das Verhältnis zu Religion und Kirche. All dies und noch vieles mehr hat Auswirkungen auf das Leben mit Kindern sowohl in der Familie als auch in der Erziehungsarbeit in Kindergärten, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen.
Die Pädagogik ist einem ständigen Wandel unterworfen – die Bedürfnisse der Kinder auch?
Heute gibt es ein breit gefächertes Spektrum, was das Angebot in vorschulischen Bildungseinrichtungen betrifft: Von Montessori-, Waldorf-, Natur- und Waldkindergärten bis hin zu Phorms, vom situations- oder subjektorientierten Ansatz, offenen oder halboffenen Konzept, Freilandpädagogik…ist die Rede. Eltern sollen oder dürfen sich vielmehr entscheiden, wo ihr Kind einen großen Teil des Tages verbringt und nach welchen pädagogischen Leitmotiven es erzogen wird.
Wie war es damals, 1922, als der Kindergarten gegründet wurde? Wie lebte und arbeitete man mit den Kindern? Welches Spielzeug/Materialien standen zur Verfügung? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, wandte ich mich vor mehr als 20 Jahren (zum 80-jährigen Jubiläum des Kindergartens) an Frau Maria Buchenberg, die über 50 Jahre, davon 44 Jahre als Leiterin, im Kindergarten
St. Lorenz tätig war und bekam einen reichen Schatz an Informationen.
Der Kindergarten wurde im Jahr 1922 durch H.H. Geistlichen Rat Manseicher, Pfarrer in St. Lorenz, gegründet. Der Kindergarten wurde getragen vom
St. Vinzentius-Verein, der durch die Beiträge der eingetragenen Mitglieder unterstützt wurde. Die Beiträge der Eltern waren zu dieser Zeit sehr gering. Unser Kindergarten war von Anfang an einer der wenigen unter der Leitung einer weltlichen „Kindergärtnerin“. Fast alle Einrichtungen dieser Art waren zu der Zeit unter der Trägerschaft einer Ordensgemeinschaft mit Schwestern besetzt. Die erste Unterbringung der Kinder erfolgte im Gebäude Muspillistr. 5. Von 8.00 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr besuchten etwa 30 Kinder aus den Familien von Bauern, Handwerkern und Arbeitern wie Maurern, Ziegeleiarbeitern etc. den Kindergarten. Am Mittwoch Nachmittag war der Kindergarten geschlossen, am Samstag Vormittag geöffnet. Die Kinder verbrachten somit zunächst nur entweder max. 4 Stunden in der Vormittagsgruppe bzw. max. 3 Stunden in der Nachmittagsgruppe im Kindergarten. Das Mittagessen wurde in der Familie eingenommen.
Die Einrichtung war sehr einfach. Holzbausteine (meist Abfälle aus der Oberföhringer Schreinerei), Stofftiere, Kaufladen, Papierabfälle aus der Druckerei waren Spiel- und Beschäftigungsmaterialien für die Kinder, dazu noch Naturmaterial wie Steine, Tannenzapfen und Blätter. Schaukelpferd, Puppenküche, Schubkarren und Sandspielzeug waren eine große Bereicherung. Töpfe, Schüsseln, Deckel und Kochlöffel aus dem Haushalt der damaligen Kindergärtnerin dienten den Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren als Musikinstrumente.
Auf der Längsseite des Kindergartens stand auf einem breiten Mauerband in großen gothischen Buchstaben: „Kindergarten des Vinzentius Vereins“ (dieses Mauerband ist auch heute noch zu sehen).
Nach Pfarrer Manseicher kam Geistl. Rat Ludwig Attenberger, unter dem der Kindergarten in den niederen Anbau verlegt wurde, der bis dahin als Turnhalle für die Jugend eingerichtet war. Dieser Raum wurde zum größten Gruppenraum des Kindergartens. Anstelle der ersten „Tante“ trat 1926 Frau Ida Hierstetter ihren Dienst als neue Leiterin des Kindergartens an und prägte ihrer Wirkungsstätte eine neue Note auf – ganz nach der Pädagogik Friedrich Fröbels.
Friedrich Fröbel (1782 – 1852) war der Begründer des ersten deutschen „Kindergartens“ und führte die „Freiarbeit“ (Freispiel) in die Pädagogik ein.
Das Spiel als typisch kindliche Lebensform hatte für ihn einen großen Bildungswert.
Die Pädagogik F. Fröbels und seine von ihm entwickelten Spiel- und Lernmaterialien sind auch heute noch in der Erziehungsarbeit von großer Bedeutung.
So wurde Fröbel-Material, wie z.B. Baukästen, Legetäfelchen, Flechtblätter, Stickkarten und dergleichen mehr angeschafft. Zu den wenigen Bilderbüchern kamen neue hinzu, es gab Malkreiden und Wasserfarben. Triangeln, Trommeln und Cymbeln lösten das „Küchenorchester“ ab.
Alle religiösen Feste im Jahreskreis wurden mit den Kindern gefeiert.
Zur Johannisbeer-, Kirschen- oder Birnenzeit wurde der Tisch feierlich für diese Kostbarkeiten gedeckt. Im Winter waren natürlich Schneeballschlacht, Schneemannbauen und oft sogar rodeln angesagt, was zu damaliger Zeit auf dem noch ganz freien Gelände um die ehemalige Ziegelei möglich war. Die Natur, das freie Gelände rund um den ehemaligen „Dorfkern“, in dem sich der Kindergarten befand, waren neben dem Kindergartengelände Spielorte für die Kinder. Das Erleben der Jahreszeiten, Sinneserfahrungen in der Natur waren für die Kinder selbstverständlich und bedurften keiner dafür speziell angesetzten „Aktionstage“ oder „Projekte“.
Frau Maria Buchenberg, die schon seit 1939 im Kindergarten mitarbeitete, löste 1944 „Tante Ida“ als Leiterin ab.
In den Jahren nach dem Krieg herrschte große Armut, auch im Kindergarten.
Bis 1950 war die Zahl der Kinder auf 45 – 50 angestiegen – ohne Hilfskraft, heute unvorstellbar!
In den Jahren 1959/60 wurde unter Pfarrer Mühlegger ein neuer Anbau Wirklichkeit.
50 Kindergartenkinder wurden für 11 Monate in die 3-Zimmer-Wohnung des Mesners ausquartiert. Im Juli 1960 konnte der Neubau (Anbau an den bereits bestehenden Teil) bezogen werden. Weitere Bauvorhaben folgten, um die Vorschriften des Bayer. Kindergartengesetzes zu erfüllen: Der überdachte Freisitz wurde zu einem Gruppenzimmer, der Luftschutzkeller Gymnastikraum, die an den Kindergarten angrenzenden Wohnung wurde zum „Intensivraum“.
Erst nach Erfüllung all dieser notwendigen Auflagen wurden am 1. Januar 1978 vom Schulreferat der Landeshauptstadt München die endgültige Anerkennung und damit verbunden finanzielle Zuschüsse erteilt.
Mit großem Engagement leitete „Tante Maria“ den Kindergarten über 4 Jahrzehnte. Die von ihr praktizierte Arbeitsweise gründete ebenfalls im Wesentlichen auf der Erziehungsphilosophie Friedrich Fröbels sowie auf der Basis christlicher Grundwerte. Viele der Gedanken dieses großen Pädagogen sind bis heute in unserem Kindergarten selbstverständlich. So war z.B. die maßgebende Grundlage der Kindergartenpädagogik für Fröbel, wie zuvor erwähnt, das SPIEL:
„Das Spiel dieser Zeit ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung…
Spiele sind Herzblätter des ganzen künftigen Lebens:
Ein Kind, welches tüchtig, still, ausdauernd, bis zur körperlichen Ermüdung spielt,
wird gewiß auch ein tüchtiger, stiller, ausdauernder, Fremd- und Eigenwohl mit Aufopferung befördernder Mensch.“
Die Hauptziele der Pädagogik sind mit denen in der heutigen Kindergartenarbeit identisch: Die Förderung der Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung des Kindes sowie der Sinneswahrnehmung (das Greifen kommt vor dem „Be-Greifen“).
Frau Maria Buchenberg übergab 1988 die Leitung an Frau Ruth Mühlenmeister
(1988 – 1990), es folgten Frau Christa Schlothauer (1990 – 1998), Sr. Jutta Beck
(1998 – 2000) und seit 2000 Frau Martina Weiss.
Unter Pfarrer Bernhard Bienlein wurde der schon lange anstehende Neubau Wirklichkeit. Nach über 2 Jahren Unterbringung in Containern im Pfarrgarten während der Bauphase, konnten im Frühjahr 2005 über 70 Kindergartenkinder in den zweigruppigen Neubau bzw. eine Gruppe in den sanierten Teil im Altbau „einziehen“.
Seit dem 1.8.2005 ist das bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit Ausführungsverordnungen in Kraft getreten, nach dessen Grundlagen sich die heutige Arbeit in den Kindergärten auszurichten hat.
In den letzten Jahren wurde überlegt, ob und wie man die im Altbau befindliche „Tigerentengruppe“ an das Haupthaus angliedern könnte.
Im Jahr 2021 hat die Kirchenstiftung St. Lorenz beschlossen, den Betrieb der Gruppe im Altbau bis Ende August 2022 laufen zu lassen und ab September 2022 aufgrund baulicher Mängel des gesamten Gebäudes einzustellen.
Somit verbleiben 2 Gruppen im Haupthaus.
Und was wünschen wir dem Kindergarten für die Zukunft?
Ich wünsche dem Kindergarten St. Lorenz vor allem immer wieder Menschen, die mit viel Liebe, Geduld, Kreativität und der nötigen Gelassenheit an ihre Arbeit herangehen, weil Kinder sich nur dort gut entwickeln können, wo sie sich wohl und geborgen fühlen und auch das hat sich über die Jahre nicht verändert…
Martina Weiss
Sommerfeste im Pfarrverband
Nach zwei Jahren, pandemiebedingt ohne Sommerfeste, konnten wir 2022 sowohl in St. Thomas am 03.07. als auch in St. Lorenz am 23.07. zu den Patrozinien endlich wieder Pfarrfeste feiern.


Bei besten Sommerwetter war vieles wie in früheren Jahern – und doch wieder ganz anders.


Die Salatbar – bewährt in St. Thomas hat – sich auch in St. Lorenz etabliert. Trotzdem war der Grill dort wieder der zentrale Punkt.

Eigentlich aus der Not geboren, weil der Caterer ausgefallen war, haben sich die Grillhändl in St. Thomas als perfekte Neuerung erwiesen.
Die Singvögel erneuern sich fortlaufend – und erfreuen uns immer wieder. Aber auch die ruhigen und erfrischenden Momente waren wunderbar. Und ein Ausklang bei Kaffe und Kuchen rundeten die Tage ab.


Von der Vielzahl der Mitfeiernden waren wir (positv) überrascht – auch hier war es fast wie früher. Die Zahl der Helferinnen und Helfer, die sich frühzeitig verpflichtet hatten, war dagegen über die Cornona-Zeit deutlich zurück gegangen. Hier müssen wir für das nächste Jahr noch mal etwas nachlegen…

Fotos: Robert Strauß, Klaudia Frank, Melanie Ratzek, Uwe Marx
Neuer Altar, Ambo und Taufstein für die Johanneskirche – Impressionen von der Altarweihe am 23. Juni 2022
Am Donnerstag 23. Juni hat Weihbischof Rupert Graf Stolberg den neuen Altar in der Johanneskirche geweiht.
Der neue Taufstein wird gesegnet. In der Kirche, die dem Mann geweiht ist, der Jesus getauft hat – Johannes dem Täufer – ist nun ein eigner Ort für den Beginn des Lebens in enger Verbindung mit Jesus Christus
Frau Hartmann trägt am neuen Ambo zu ersten Mal eine Lesung vor. Er ist der Tisch des Wortes Gottes, von dem Jesus uns sagt, dass es wirklich eine Speise ist (Joh 6,55).
Mit der Allerheiligenlitanei wird die Fürsprache des Himmels angerufen. Jesus ruft uns um seinen Altar seiner Hingabe herum zu einer großen, solidarischen Gemeinschaft, die bis in den Himmel hineinreicht.
Der Künstler Toni Stegmayer verschließt die Altarnische mit den Reliquien des Hl. Korbinian und des seligen Otto. Schon in frühester Zeit haben Christen über den Gräbern ihrer Märtyrer die Heilige Messe gefeiert. Bei jeder Feier in der Johanneskirche wissen wir uns besonders mit den beiden großen Bischöfen unserer Diözese Korbinian und Otto verbunden.
Der Altar wird gesalbt. Er steht symbolisch für Jesus „Christus“, d.h. für Jesus „den Gesalbten“ (Lukas 4,18).
An fünf Stellen wird Weihrauch entzündet. Die Feuerstellen erinnern an die fünf Wunden Jesu, durch die er uns Heilung bringt (Jesaja 52,13)
Im Weihegebet erbittet der Bischof den Segen Gottes für alle Menschen, die künftig hier die Eucharistie feiern.
Zum ersten Mal werden die Gaben – Brot und Wein – zu diesem Altar gebracht. Der Weihrauch ist Zeichen dafür, dass sie ganz und gar Zeichen der heiligen Gegenwart von Jesus werden sollen.
Zum ersten Mal spricht der Bischof die Doxologie, den großen Lobpreis des eucharistischen Hochgebetes und erhebt dabei mit dem Diakon zusammen den Leib und das Blut Christi. Der Altar ist zum Ort der höchsten Gegenwart Gottes geworden.
Fotos: S. Kellerer – Studio Niggl, München
Hier erfahren Sie den Hintergrund dieses großen Ereignisses:
„Wir stehen vor einer alten Taufkirche.“ Diese Worte von Reinhard Kardinal Marx beim 1200. Geburtstag im Jahr 2015 waren der letzte Anstoß für die Neugestaltung des Altarraums unserer Johanneskirche.
Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung haben dafür gestimmt, einen neuen Volksaltar, Ambo und Taufstein zu errichten. Das Kunstreferat des Erzbistums gab daraufhin einen Künstlerwettbewerb in Auftrag, den der renommierte Steinbildhauer Toni Stegmayer gewonnen hat.
Nach vielen weiteren Diskussionen, Ideen und Detailüberlegungen ist in Zusammenarbeit mit der Erzbischöflichen Bau- und Kunstkommission ein von allen Gremien einstimmig befürworteter Entwurf entstanden.
Dieser Entwurf beinhaltet auch die vom Erzbistum erbetene Wiederherstellung des kostbaren Hochaltars, so wie ihn der große Meister des Barock, Ignaz Günther, geschaffen hat. Am 26. Oktober 2021 wurde er öffentlich vorgestellt.
Indem der 1939 in den Altar eingebaute Tabernakel seinen Platz an der nördlichen Chorwand findet, können die beiden Engel und das Bild des gegeißelten Jesus an ihren ursprünglichen Ort im Hochaltar zurückkehren.
Hier sehen Sie eine Fotomontage:
Platz für Tabernakel und Taufort entsteht in der beengten Kirche durch Verzicht auf die Unterbauten der schon in den 1950er-Jahren entfernten Seitenaltäre, unter deren Podesten es zudem schimmlig ist. Die Unterbauten werden im Kunstarchiv der Erzdiözese in Neumarkt St. Veit eingelagert.
Der neue Altar aus hellem Kalkstein in Form eines griechischen Tau soll sich farblich und in der Formensprache in den Chorbogen der Kirche einfügen aber auch den Blick zum kostbaren Hochaltar offenhalten.
Zugleich verbindet der Chorbogen die verschiedenen Orte: In der Mitte der Altar. Auf der Sakristei-Seite der Ambo, Ort des Wortes Gottes, und der Tabernakel, Ort der bleibenden Gegenwart Jesu in der Eucharistie.
Auf der anderen Seite der Taufstein, Ort des Anfangs eines Lebens mit Gott und der Kirche, und die Marienfigur, mütterliches Vorbild, wie wir als Christen leben sollen.
Der Begegnungsgarten wächst
Wochenende für Wochenende und immer wieder auch unter der Woche wächst der Begegnungsgarten auf der Steuobstwiese von St. Lorenz.
Jeden Sonntag nach dem 10.30 Uhr Gottesdienst haben fleißige Helferinnen und Helfer Kuchen und belegte Brot angeboten um Begegnung zu ermöglichen und auch Spenden zu sammeln.
Insgesamt fast 30 Personen waren beteiligt, wie Büsche versetzt, Platten gelegt, Löcher gegraben, Bänke gebaut und vor allem eine wunderschöner Ort für eine Muttergottesstatue geschaffen wurde.
Immer wieder bleiben schon jetzt Spaziergänger stehen oder kommen für ein kurzes Gebet in den Garten. Besonders die Kinder der Mittagsbetreuung haben die Marienfigur ins Herz geschlossen.
Wer gerne mithelfen will kann einfach vorbei schauen oder aber eine Mail schreiben an begegnungsgarten(at)st-thomas-lorenz.de.
Neue Gottesdienstordnung für den Pfarrverband ab Pfingsten
Ab Pfingsten gilt für Sonn- und Feiertage eine neue Gottesdienstordnung.
Unverändert bleiben folgende Gottesdienste:
- Samstag, 18:30 Uhr hl. Messe in St. Thomas
- Sonntag 8:30 Uhr hl. Messe in St. Thomas (wenn es Corona verantwortlich wieder zulässt in der Johanneskirche)
- Sonntag 19:00 Uhr hl. Messe in St. Lorenz
Für die bisherigen 10.30 Uhr und 10.00 Uhr Gottesdienste gibt es eine neue Regelung:
Die Gottesdienste werden in Zukunft immer gemeinsam gefeiert, d.h. jeden Sonntag findet um 10.30 Uhr abwechselnd im 2-Wochen Rhythmus entweder in St. Lorenz oder in St. Thomas eine Heilige Messe statt.
Damit Sie leicht den Überblick behalten können wird es immer einen langfristigen Kalender geben. Die aktuelle Ausgabe finden Sie hier:
An Feiertagen findet die 10.30-Messe in der Kirche statt, in der am Sonntag vorher kein 10:30 Gottesdienst war. Abendmessen werden an Feiertagen nur noch im Einzelfall gefeiert.
Für besondere Feiertage werden die Gottesdienste werden im Einzelfall festgelegt. Beispielsweise am Heiligen Abend gibt es sowohl in St. Thomas als auch in St. Lorenz eine Christmette.
Für unseren Osterpfarrbrief 2022 ist folgendes Interview über die Entstehung der neuen Gottesdienstordnung mit Matthias Honal, dem PGR-Vorsitzenden von St. Lorenz entstanden:
Welche Vorbedingungen gab es für die neue Gottesdienstordnung?
Im Hinblick auf die rückläufige Zahl aktiver Seelsorger im Pfarrverband und weil aktuell wie zukünftig häufig ein Kirchenmusiker viele Gottesdienste gestalten muss, kann es regelmäßig nur noch vier Gottesdienste am Wochenende geben, die nie parallel stattfinden können.
Damit es auch nach den Gottesdiensten zumindest die Chance auf ein kurzes persönliches Wort mit dem Zelebranten gibt und für die Musik Zeit zur Vor- und Nachbereitung bleibt, braucht es einen gewissen Mindestabstand zwischen den Anfangszeiten.
Das waren die wirklich unumstößlichen Vorbedingungen.
Denkbar sind dann vier grundsätzliche Möglichkeiten:
- Feste Gottesdienstzeiten – wechselnde Kirchen
- Feste Gottesdienstzeiten – feststehende Kirchen
- Wechselnde Zeiten – feststehende Kirchen
- Wechselnde Zeiten – wechselnde Kirchen.
Alle Modelle haben Vor- und Nachteile, wie schwierig war die Entscheidung?
Schon in Vorgesprächen hat sich gezeigt, dass es unterschiedliche Blickrichtungen gibt, aber alle wirklich um eine gute gemeinsame Lösung bemüht sind.
An diesem Samstag haben wir uns die nötige Zeit genommen, um noch mal alle verschiedenen Modelle zu sammeln und konkret aufzuschreiben. Gemeinsam haben wir versucht, die Vor- und Nachteile zu gewichten – immer mit dem Bemühen, auch andere Sichtweisen und Lebenswirklichkeiten im Blick zu behalten. Was für den einen eine gute Gottesdienstzeit ist, kann
z.B. für eine Familie einfach unmöglich wirken.
Das ist aufwändig, aber im Verlauf des Vormittags hat sich die Zahl der wirklich brauchbaren Möglichkeiten schnell reduziert und am Ende hat die Abstimmung sehr eindeutige Mehrheiten gebracht.
Und warum ist es nun das Modell mit dem wechselnden Gottesdienst am Sonntag um 10:30 Uhr geworden?
Das gewichtigste Argument war am Ende, dass bei zwei oder auch nur 1 ¾ Stunden Abstand zwischen dem Beginn zweier Gottesdienste immer mindestens einer auf „Randzeiten“ fällt, die dann Begegnungen und Feste danach schwer möglich machen und für viele Teilnehmer große Umstellungen bedeutet hätten. 10:30 Uhr ist eine wirklich gut eingeführte Zeit für einen Sonntagsgottesdienst – bis zur Pfarrverbandsgründung war das der Hauptgottesdienst in unseren beiden Pfarreien.
Wichtig war es aber auch, in allen drei Kirchen verlässlich Gottesdienste möglich zu machen und nur dort etwas zu ändern, wo es dadurch echte Vorteile gibt.
Der zentrale Gottesdienst am Sonntag ist uns letztlich so wichtig, dass wir für Alle die Möglichkeit schaffen wollen, mitzufeiern.
Und wie sind die Feiertage geregelt?
Feiertagsgottesdienste werden in der Regel in der Kirche gefeiert, in der am Sonntag vorher keine 10:30 Uhr Messe stattgefunden hat. Gleichzeitig haben wir beschlossen, an bestimmten Feiertagen keine Abendmesse mehr anzusetzen.
Besondere Gottesdienste, wie die Osternacht gibt es in beiden Kirchen zu den bisher gewohnten Zeiten und am Heilig Abend wird es parallel zwei Christmetten geben.
Sind Sie persönlich zufrieden mit dem Ergebnis?
Ich bin mit einem anderen Favoriten in die Gespräche gegangen. Als Moderator habe ich mich aber bemüht, nicht manipulativ in meine Richtung zu lenken.
Am Ende hat mich der starke Konsens nach der aufrichtigen Suche sehr gefreut und ich denke inzwischen, dass wir das beste Ergebnis für den Pfarrverband erzielt haben.
Ich sehe eine echte Chance zu mehr Gemeinschaft und lebendigem Glauben in unserem Pfarrverband, wenn sich die Gottesdienstgemeinden stärker vermischen.
Die feste Zeit 10:30 Uhr erleichtert Begegnungen und Feste nach dem Gottesdienst. Nach den vergangenen zwei Jahren in der Pandemie ist es das, was viele vermissen. Wenn wir die Idee gegenseitiger Gastfreundschaft aufgreifen, können wir immer wieder Gelegenheiten schaffen, zusammen zu bleiben – einfach gesellig, genauso aber auch um im Gottesdienst Gehörtes zu vertiefen.
Brief aus Lima
Sr. Carlota Calle Remaicuna, smsm, Koordinatorin der Gefängnisseelsorge Miguel Castro C. schreibt:
„Lieber Pfarrer Willi und liebe Pfarrgemeinde von Sankt Thomas.
Es ist mir eine Freude, Sie zu grüßen und Ihnen gleichzeitig die große Dankbarkeit der Insassen des Gefängnisses Miguel Castro Castro zu übermitteln…“
Lesen Sie den gesamten Brief in der Deutschen Übersetzung oder im Englischen Original.
Auch hat Schwester Carlota Impressionen von der Karwoche 2022 im Gefängnis Castro Castro (Lima) geteilt – auch dort unter Corona-Schutzmaßnahmen:

Kindergottesdienst „Vom himmlischen Jerusalem“
Hier ein paar Impressionen von unserem Kindergottesdienst in Sankt Lorenz, am Sonntag, den 15. Mai 2022 auf der Streuobstwiese:
Wir hören die Vision vom himmlischen Jerusalem (Offb 21, 1-5a):
Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine heilige Stadt, die vom Himmel herabkommt.
Mit Klötzen, goldenen Kugeln und bunten, leuchtenden Muggelsteinen bauen die Kinder mitten in einen goldenen Reifen (Symbol für das, was uns heilig ist) ein himmlisches Jerusalem. Sie gestalten auch ein buntes Bild, das wir am Ende in die „Kirche der Großen“ mitnehmen.
Die Kinder sprechen bei jedem Bauklotz, den sie legen, ihre Visionen von der paradiesischen Friedensstadt aus:
- Die Menschen teilen, es gibt keine Einsamen, keine Armen und Reichen, keinen Streit, keinen Krieg.
- Alle denken an die Umwelt.
- Niemand nimmt dir alles weg oder macht alles kaputt.
- Die Menschen haben den Glauben.
- Es ist alles grün, voller bunter Blumen und mit ganz viel Musik…
Dazu singen wir: „Halte deine Träume fest, lerne sie zu leben!“. Denn für uns Christen verändert die Vision vom himmlischen Jerusalem, wie Gott mitten unter uns wohnt und unsere verwundete Welt zu einem guten Ende führt, schon heute unser Leben.
Begegnungsgarten in St. Lorenz
Ein Anfang ist gemacht – am letzen Donnerstag bei unserem ersten Treffen waren viele „Interessierte“ für den Begegnungsgarten da und wir konnten uns gut austauschen. Wir alle teilen die Liebe für diesen besonderen Ort und wir sind uns einig, dass es schön ist, wenn sich mehr Menschen dort öfter treffen können.
Nun, wie geht es weiter?
Um gemeinsam und mit allen in der Gemeinde im „Prozess“ der Ideenfindung weiter zu kommen und um schon gleich die Begegnung zu schaffen, die ja unser Ziel ist, wollen wir an den nächsten Sonntagen, angefangen am 08.05.2022 (Muttertag) nach der Messe schon Kaffee und Kuchen dort auf der Wiese anbieten und eventuell Spiele machen.
Neben Ideen und Mitwirkenden wollen wir auch beginnen Spenden zu sammeln – Näheres ab nächsten Sonntag bei Kaffee und Kuchen!
Spendenkonto:
Kirchenstiftung St. Lorenz,
Stichwort „Begegnungsgarten“,
DE 97 7509 0300 0002 1440 18,
LIGA München.

Du bist dabei hast keine Zeit?
Melde Dich bei Gabriele Linder Dorfner